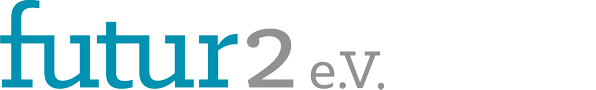Was wir Arbeit nennen – vom Mythos zum Engagement
Manche nennen uns Faule oder Workaholics. Manche sagen, wir könnten uns nicht unterordnen und nicht richtig mit unserer Freiheit umgehen. Eines aber kann man uns nicht nachsagen: Dass wir keine Lust auf Arbeit hätten.
Zugegeben, unsere Idee von Erwerbsarbeit unterscheidet sich eklatant von der der Generationen vor uns und von den Vielen, neben denen wir heute an der Werkbank stehen. Die Phasen, die das Verständnis von Arbeit in den vergangenen Jahrhunderten durchgemacht hat, sind hinlänglich bekannt. Von der Subsistenz-Wirtschaft auf einer eigenen Scholle hin zur Abhängigkeit und zur Ausbeutung der Arbeiter durch die Besitzer von Produktionsmitteln im Zeitalter der Industrialisierung; über den Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder hin zur Angestelltenmentalität der sechziger und siebziger Jahren, bis hin zur Selbstausbeutung der Managerklasse an der Jahrtausendwende.
Erfolgte die Arbeit zunächst für die eigene Versorgung, wurde sie hernach lohnabhängig und der Ausgleich zwischen Arbeiter und Fabrikbesitzer geschah über Verhandlungen der Sozialpartner. Es gab Arbeiter und Angestellter und es gab den Boss, dem der Betrieb gehörte. Und es gab das Heer öffentlicher Angestellter in Behörden, Banken und Verbänden. Denen ging es immer schon ein bisschen kommoder, als den Arbeitern im Staub. Nicht nur, dass die Umgebung sauber war. Wer verwaltete, musste nicht unbedingt gestalten. Es gehört bis heute zum Wesen einer guten Verwaltung, einfach zu funktionieren.
In Deutschland ist Arbeit ein Mythos. Sie wird als Beitrag zu Wachstum und Wohlfahrt verstanden, in dunklen Zeiten zum Aufbau einer so genannten „Volksgemeinschaft“ oder, in besseren Zeiten, der Wohlstandsgesellschaft, zuletzt als Mittel zum grenzenlosen Wachstum angesichts globaler Konkurrenzverhältnisse. Wer etwas auf sich hält, definiert seine Persönlichkeit über die Arbeit. Bevor man Menschen richtig kennenlernt, fragt man, was sie beruflich tun. So als würden Beruf und Tätigkeit, die mittlerweile auch nicht mehr kongruent sind, die zentralen Persönlichkeitsmerkmale des Menschen sein.
Das Arbeitsverständnis heute ist vielfältig. Was früher Subsistenzwirtschaft war, ist heute die Erwerbsarbeit zum Zwecke des Verdienens. Man hat einen Job, keinen Beruf. Das sollte Spaß machen, aber im Rahmen bleiben. Das Hauptengagement des Lebens gilt dem Fußballverein, dem Hobby, der Familie. Dann gibt es die Urlaubsarbeiter. Sie verkaufen ihrem Arbeitgeber einen gewissen Umfang an Lebenszeit. Im Vordergrund stehen nicht der Sinn dessen, was zu tun ist oder gar Effizienz oder Effektivität. Sie erfüllen, sicher gewissenhaft, ihren Arbeitsvertrag mit dem vereinbarten Stundenkontingent, egal, ob viel oder wenig Arbeit anfällt. Wer den Mythos pflegt, stellt Quantität über Qualität und Anwesenheit über Output. Verantwortung und Denken wird da gerne schon einmal ausgeblendet, ist im monatlichen Gehaltsscheck nicht enthalten. Und dann gibt es die Engagierten, die auch gut verdienen, die selbstverständlich weitaus mehr als die vertragliche Arbeitszeit ableisten, dies aber auf Kosten von Privatleben und Familien. Wenn sie aus dem Haus gehen, ist es dunkel, wenn sie abends wieder kommen, ist es auch dunkel. Im Idealfall sind sie Singles, dann können sie die freie Zeit am Abend noch in der Tapas-Bar mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Team verbringen. Sie tun so, als würde das gesamte Leben hauptsächlich aus Arbeit bestehen.
Ist Arbeit das, was das Leben ausmacht? Oder ist sie nur unnützes Beiwerk, um leben zu können? Mit gelbem Textmarker sind schon zu Beginn des Jahres die Urlaubstage markiert? Geschickt jongliert man mit den Brückentagen, um einen möglichst breiten Zeitraum ausnutzen zu können? Das Büro schmücken großformatige Bilder vom letzten Sommerurlaub im Safariressort. Die Sehnsucht des Angestellten gilt dem nächsten Urlaub, dem nächsten Training, der Bundesligakonferenz am Sonnabend oder der Ruhe am Sonntagnachmittag. Die Sehnsucht der Ehrgeizigen gilt dem “Noch-mehr”, noch mehr Stunden, noch mehr Erfolg. Ein Hamsterrad ohne Ende.
Und wir? Uns fällt es schwer, zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden. Nicht, weil wir ständig arbeiten wollen, um unseren Ehrgeiz zu befriedigen, sondern weil wir flexibel bleiben wollen. Das Wetter ist gut, es liegt nichts Dringendes an? Raus an den Strand. Mit den Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, sind wir jederzeit erreichbar. Gerade läuft ein geiles Projekt, in das wir unser ganzes Herzblut gesteckt haben? Da wird keiner um vier Uhr aus dem Haus gehen und den Schreibtisch Schreibtisch sein lassen. Wir wollen nicht wegschaffen, wir wollen gestalten. Der Erfolg des Projekts ist auch unser Erfolg, weil’s Spaß macht und weil’s auch stolz macht, ein erfolgreiches Ergebnis zu sehen. Elternzeit und Sabbatical dürfen nicht das Ende der Karriere bedeuten, sondern sind die Krönung der Flexibilität. Die Arbeitszeit ist uns egal (dem Dienstherrn und den Gewerkschaften nicht immer), nicht, weil wir uns ausbeuten lassen wollen, nicht, weil wir „betrügen“ wollen, sondern weil wir am Output orientiert arbeiten. Wir haben unser eigenes Tempo, wollen uns weder von der Stechuhr treiben noch von ihr ausbremsen lassen. Wir lieben gute Ideen und wissen, dass man gute Ideen binnen 72 Stunden umsetzen sollte. Wie könnten wir gelassen sein, wenn uns der Sinn einer Tätigkeit oder eines Arbeitsablaufes nicht einleuchtet, erst recht nicht, wenn uns bedeutet wird, man habe das immer so gemacht? Dient es dem Ergebnis oder bremst es? Wir hinterfragen gerne – der Sache wegen. Wir haben Lust auf Begegnungen und darauf, Neues zu lernen. Und es kann durchaus sehr effektiv sein, mit engagierten Mitdenkern drei Stunden im Café zu hocken. Wir verweigern uns der verbreiteten Sichtweise, Arbeit finde zwischen Neun und Fünf an der Werkbank oder dem Schreibtisch statt. Wir wollen unsere Arbeit in unser Leben integrieren und wenn uns nachts um Elf noch eine passende Antwort auf die Mail vom Vormittag einfällt, dann gibt’s das Smartphone. Warum auch nicht? Solange der Output stimmt, stimmt die Arbeitszeit und wer auch nachts noch gute Ideen hat, kann dem Töchterchen auch vormittags beim Turnfest helfen.
Vor allem wollen wir etwas verändern und bewegen.
Weder unsere Arbeitsgesellschaft noch unsere Wohlstand werden daran zugrunde gehen. Ganz im Gegenteil. Wenn es uns gelingt, ein neues Verständnis von Arbeit zu finden, ein flexibleres, smarteres, wird es auch agiler sein, gute Ergebnisse geben, materielle und immaterielle. Gewinnen werden wir alle, die Individuen und das Kollektiv. Der Glücksindex wird steigen, sicher. Und das Wirtschaftswachstum wird nicht fallen – ebenso sicher. Das ist, was wir unter Arbeit verstehen. Zugegeben, unsere Idee von Erwerbsarbeit unterscheidet sich eklatant von der der Generationen vor uns und von vielen, neben denen wir heute an der Werkbank stehen. Manche nennen uns faul oder Workaholics. Manche sagen, wir könnten uns nicht unterordnen und nicht richtig mit unserer Freiheit umgehen. Eines aber kann man uns nicht nachsagen: Dass wir keine Ideale und keinen Sinn in unserer Arbeit und in unserem Leben hätten.